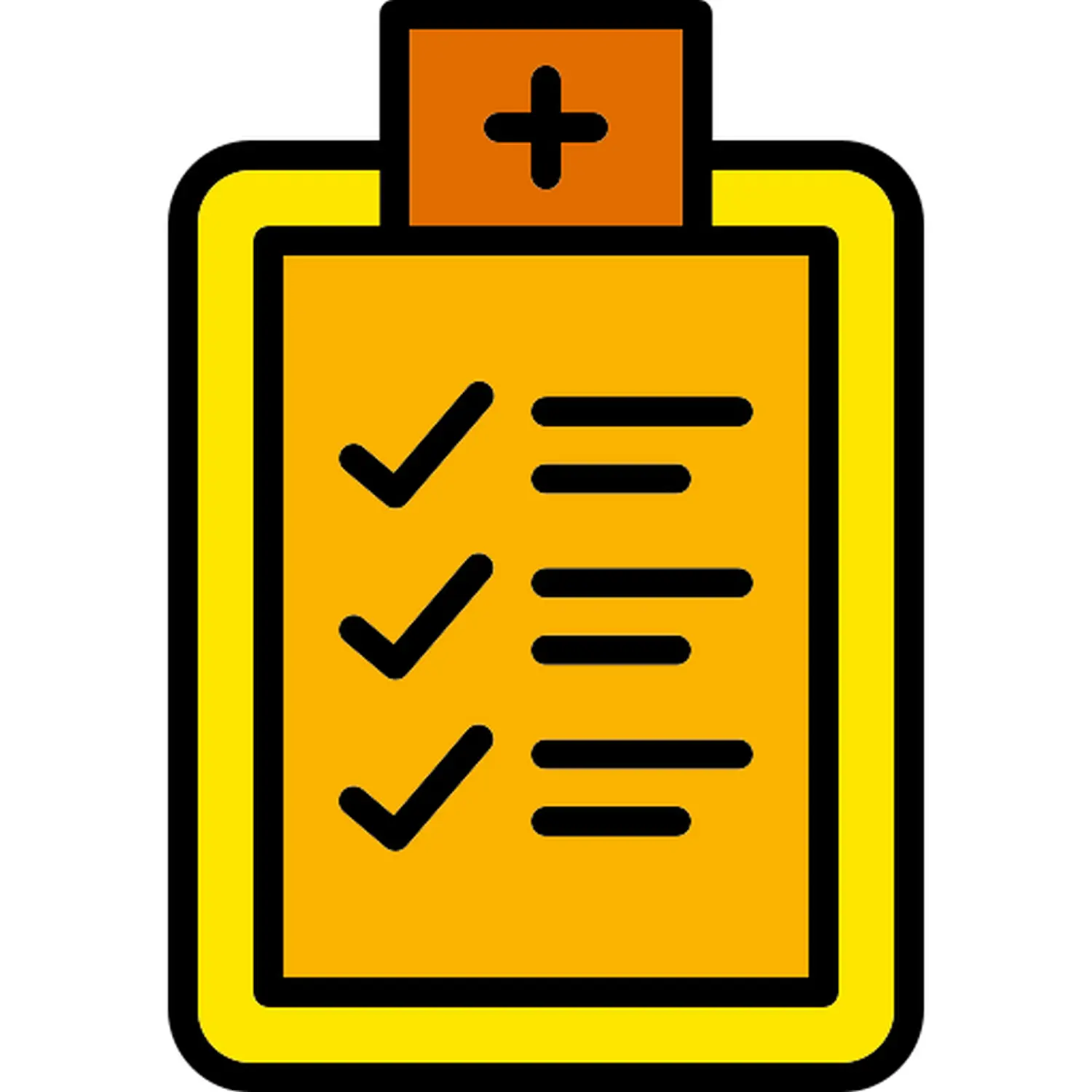Wie oben erläutert, handelt es sei bei einem CRPS um eine Ausschlussdiagnose, bei der immer auch an sogenannte Differenzialdiagnosen gedacht werden muss. Eine gute Diagnostik kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Ist das immer sinnvoll?
Das CRPS selbst kann nicht gemessen oder mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen werden. Jedoch können zum Ausschluss möglicher andere Erkrankungen bildgebende Diagnostikverfahren hinzugezogen werden. Das CRPS selbst geht nicht mit Auffälligkeiten bei Routinelaborparametern wie z. B. CRP-Erhöhung oder BSG-Beschleunigung einher. Manchmal geht dann wertvolle Zeit verloren, weil man auf Termine zur Abklärung anderer Ursachen für die Symptomatik warten muss. Einen therapeutischen Zweck haben die Untersuchungen nicht und auch ein CRPS kann nicht anhand einer Skelettszintigraphie diagnostiziert oder ausgeschlossen werden. Im Zweifel ist es sinnvoll, ein mögliches CRPS entsprechend zu behandeln und parallel die Differenzialdiagnosen prüfen.
Chronischer Nicht- oder Mindergebrauch einer Gliedmaße auf Grund einer anderen Ursache als CRPS kann zu vergleichbaren Veränderungen führen. Je länger das CRPS besteht, desto schwieriger wird die Unterscheidung der Ursachen. Daher ist eine Bilddokumentation sinnvoll. Unsere Probleme entstehen nicht einfach durch geringen Gebrauch der Gliedmaße, sondern auf Grund der Schmerzen und Einschränkungen benutzen wir sie weniger. Schmerzen und Funktion (anhand von Kraft, Bewegungsumfang, Umfangsmessung) sollten von Beginn an fortlaufend dokumentiert werden. Dafür kann auch die CRPS-Schwereskala CSS verwendet werden.
Für den Ausschluss anderer Erkrankungen bzw. Ursachen kann ein Blutbild gemacht werden. Der Wert des C-reaktivem Proteins (CRPs) ist ein Entzündungsmarker und beispielswese bei einer Infektion und Entzündung erhöht.
Bildgebende Verfahren
Auf dem Röntgenbild zeigen sich nur etwa bei der Hälfte der CRPS-Patient:innen charakteristische kleinfleckige osteoporotische Veränderungen des Knochens (Entkalkung) der betroffenen Extremität. Röntgenaufnahmen der betroffenen Gliedmaßen können eine Schädigung der Knochen, Gelenke und des umliegenden Gewebes bestätigen oder ausschließen.
Zeigen Röntgenbilder von CRPS-Patient:innen Auffälligkeiten, handelt es sich in der Regel um eine Entkalkung des Knochens in der betroffenen Gliedmaße, sodass der Knochen brüchig wird. Das ist jedoch typisch für einen Nicht-Gebrauch und nicht nur bei CRPS zu erwarten. Gelegentlich sind auf den Röntgenbildern in Kombination auch Weichteilschwellungen oder diffuse Weichteilatrophie („Gewebeschwund“) sichtbar.
Das 3-Phasen-Knochenszintigramm mit Technitium-99-Diphosphonat kann Veränderungen im Knochenstoffwechsel sichtbar machen. Achtung, das Knochenszintigramm kann unfallbedingt bereits eine Mehranreicherung aufweisen und ist dann nicht aussagekräftig. Ist das Szintigramm unauffällig, aber die Symptome unter Anwendung der Budapestkriterien sind eindeutig, schließt das kein CRPS aus. Die 3-Phasen-Knochenszintigraphie hat eine höhere Sensitivität als die Magnetresonanztomographie und die Röntgenuntersuchung, dort wird ein bestehendes CRPS also häufiger auch entdeckt. Die Spezifität ist ebenfalls größer, das bedeutet ein negatives Ergebnis (kein CRPS) trifft häufiger in Wahrheit auch zu. Aber das Ergebnis der 3-Phasen-Knochenszintigraphie kann auch falsch sein.
Magnetresonanztomographie (MRT) oder auch Kernspintomographie oder Kernspin-Resonanz-Tomographie – Hierbei wird im Gegensatz zur Röntgenuntersuchung nicht Strahlung, sondern ein sehr starkes und konstantes Magnetfeld genutzt. Da die verschiedenen Gewebe im Körper während der Untersuchung unterschiedlich reagieren, ist so ein Blick in das Innere unseres Körpers möglich. Strukturen mit viel Wasser können besonders gut dargestellt werden, Knochenbrüche jedoch auf Grund des geringen Wassergehalts in Knochen nicht. Veränderungen der Muskeln und des Bindegewebes durch Verletzungen, Tumore oder Entzündungen lassen sich gut sichtbar machen. So können mit Hilfe einer MRT-Untersuchung Differenzialdiagnosen ausgeschlossen oder bestätigt werden.
Aber gibt es im MRT-Befund auch CRPS-charakteristische Veränderungen? Aktuell kann ein MRT nicht mit ausreichender Sicherheit ein CRPS bestätigen oder ausschließen. In einer Untersuchung wurde festgestellt, dass Patient:innen mit CRPS Veränderungen aufweisen, die je nach Dauer der Erkrankung im MRT sichtbar sind. Patient:innen mit chronischem CRPS wiesen Veränderungen wie Atrophie („Gewebeschwund“, z. B. Muskelatrophie), Fibrose (Vermehrung von Bindegewebe statt des eigentlichen Gewebes) und Fettinfiltration auf, während neu diagnostizierte Patient:innen eine erhöhte Stoffwechselaktivität aufwiesen. Alle zeigten eine Signalverstärkung, was auf ein Ödem und eine erhöhte Durchlässigkeit der Gefäße hindeutet. Ob diese Ergebnisse sich verallgemeinern lassen, ist damit allerdings nicht klar. Hier gibt es sicher noch viel zu erforschen.
Die Schmerzempfindlichkeit kann mit einer quantitativ sensorischen Testung (QST) gemessen werden. Hierbei wird, meistens durch Neurolog:innen, die Wahrnehmungsschwelle von Reizen bestimmt. Dazu gehören mechanische Reize wie Druck, Berührung oder Vibrieren und Temperaturreize wie warm oder kalt. Die Schmerzreize liegen dabei von ihrer Intensität her an der Schwelle zur Wahrnehmbarkeit von Schmerzen und werden direkt bei der ersten leicht schmerzhaften Wahrnehmung gestoppt.
Mit der QST können Informationen zur Funktion der Nervenfasern in der Haut und zur Weiterverarbeitung der Schmerzempfindung in Rückenmark und Gehirn gewonnen werden. Mit der Messung der Nervenleitgeschwindigkeit hingegen wird überwiegend die Funktion dicker Nervenfasern untersucht. Hingegen erfasst die QST insbesondere Störungen der dünneren Nervenfasern in der Haut. Schmerz wird vor allem über letztere wahrgenommen. Eine QST kann somit den Verdacht auf eine Nervenschädigung oder -überempfindlichkeit stützen.